
Schweizer KMU sind nicht nur das „Rückgrat“ der Wirtschaft – sie sind ihr agiles Betriebssystem.
- Ihre Stärke liegt in pragmatischer Resilienz, die es ihnen ermöglichte, Krisen wie die Pandemie besser zu meistern als Grosskonzerne.
- Innovation entsteht nicht in teuren Forschungsabteilungen, sondern in einem kollaborativen Ökosystem mit Hochschulen und Partnern.
- Strategische Standortvorteile, wie im Crypto Valley Zug, zeigen, wie agil KMU Nischen besetzen und globale Trends anführen können.
Empfehlung: Um die Schweizer Wirtschaft wirklich zu verstehen, müssen wir die dynamischen Mechanismen der KMU anerkennen, anstatt uns auf das statische Bild des „Rückgrats“ zu verlassen.
Es ist eine beeindruckende Zahl, die oft als Beweis für die Stärke der Schweizer Wirtschaft herangezogen wird: Laut aktuellen Zahlen des Bundesamts für Statistik sind 99,7 % aller Schweizer Unternehmen KMU. Man bezeichnet sie gerne als das „Rückgrat der Wirtschaft“ oder als den zentralen „Jobmotor“. Diese Bezeichnungen sind zwar korrekt, greifen aber zu kurz. Sie vermitteln ein statisches Bild einer Stütze, während die wahre Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmen in ihrer Dynamik, ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrer vernetzten Intelligenz liegt. Sie sind weniger ein passives Skelett als vielmehr das aktive, lernende Betriebssystem, auf dem die gesamte Volkswirtschaft läuft.
Die wahre Geschichte der Schweizer KMU ist keine der reinen Grösse oder Anzahl, sondern eine der qualitativen Eigenschaften. Es geht darum, *wie* sie Krisen überstehen, *wie* sie Innovationen ohne riesige Budgets vorantreiben und *welche* kritischen Entscheidungen über ihr Überleben und Wachstum bestimmen. Anstatt ihre Wichtigkeit als gegeben hinzunehmen, müssen wir die verborgenen Mechanismen ihrer Resilienz und Agilität verstehen. Nur so lässt sich erklären, warum sie in unsicheren Zeiten oft stabiler sind als die Giganten und wie sie es schaffen, von der Tradition zur Disruption zu wechseln.
Dieser Artikel taucht tief in das Ökosystem der Schweizer KMU ein. Wir analysieren nicht nur ihre Rolle, sondern das Zusammenspiel aus pragmatischer Krisenbewältigung, kollaborativer Innovationskultur und den strategischen Weichenstellungen, die über den langfristigen Erfolg entscheiden. Wir beleuchten die kritischen Momente – von der Nachfolge bis zum Wachstumssprung – und zeigen auf, warum das Verständnis dieser Dynamiken für jeden Unternehmer, Gründer und wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger in der Schweiz unerlässlich ist.
Die folgenden Abschnitte bieten einen detaillierten Einblick in die entscheidenden Faktoren, die die Schweizer KMU nicht nur zum Rückgrat, sondern zum pulsierenden Herzen der Wirtschaft machen. Das Inhaltsverzeichnis gibt Ihnen einen Überblick über die spezifischen Themen, die wir untersuchen werden.
Inhaltsverzeichnis: Das Geheimnis der Schweizer KMU-Dominanz
- Warum überlebten 85% der Schweizer KMU die Pandemie, während Grosskonzerne 50.000 Stellen abbauten?
- Innovation ohne Forschungsabteilung: Wie entwickeln KMU neue Produkte und Dienstleistungen?
- Tradition oder Disruption: Welches KMU-Modell überlebt die nächsten 20 Jahre?
- Der Nachfolge-Fehler, der 50% der Schweizer Familienunternehmen scheitern lässt
- Von 20 auf 50 Mitarbeitende oder Exit: Die kritischen Entscheidungsmomente für KMU
- Von der ETH in die Fabrik: Wie entsteht Innovation im Schweizer Industrieökosystem?
- Warum zogen 1.000 Fintech-Startups nach Zug statt nach Frankfurt oder London?
- Crypto Valley Zug, digitale Banken: Wie revolutioniert Fintech den Schweizer Finanzplatz?
Warum überlebten 85% der Schweizer KMU die Pandemie, während Grosskonzerne 50.000 Stellen abbauten?
Die COVID-19-Pandemie war ein Stresstest für die gesamte Weltwirtschaft, und die Schweiz bildete da keine Ausnahme. Während grosse Konzerne mit Massenentlassungen reagierten, zeigten die Schweizer KMU eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Der Schlüssel dazu liegt nicht in grossen Kapitalreserven, sondern in einer Kombination aus staatlicher Unterstützung und unternehmerischer Agilität. Ein entscheidendes Instrument war die Kurzarbeit, die laut einer Umfrage von rund 60 % der Schweizer KMU genutzt wurde, um qualifizierte Mitarbeitende zu halten.
Doch diese Unterstützung allein erklärt nicht das Überleben. Der entscheidende Faktor war die pragmatische Resilienz der Unternehmen. Anstatt in starren Strukturen auf bessere Zeiten zu warten, passten viele KMU ihr Geschäftsmodell quasi über Nacht an. Die Wege waren kurz, die Entscheidungen schnell. Dieses Phänomen zeigte sich in vielen Branchen: Destillerien stellten ihre Produktion auf Desinfektionsmittel um, Textilunternehmen begannen, Schutzmasken zu nähen, und Restaurants bauten in Rekordzeit Lieferdienste auf. Diese Fähigkeit zur schnellen und unbürokratischen Neuausrichtung ist ein Kernmerkmal, das KMU von Grosskonzernen unterscheidet.
Diese Agilität ist kein Zufall, sondern tief in der Kultur vieler Schweizer KMU verankert. Die Nähe zum Markt und zum Kunden ermöglicht es, Bedarfsänderungen sofort zu erkennen und darauf zu reagieren. Anstatt auf komplexe Analysen und langwierige Genehmigungsprozesse zu warten, handeln Inhaber und Führungskräfte direkt. Diese unmittelbare Handlungsfähigkeit war in der Krise ein entscheidender Überlebensvorteil.
Innovation ohne Forschungsabteilung: Wie entwickeln KMU neue Produkte und Dienstleistungen?
Viele stellen sich Innovation als einen Prozess vor, der in riesigen, hochmodernen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen stattfindet. Schweizer KMU beweisen täglich das Gegenteil. Ihre Innovationskraft entspringt nicht primär aus internen Ressourcen, sondern aus einem dichten, kollaborativen Ökosystem. Sie sind Meister darin, externes Wissen zu nutzen und Partnerschaften einzugehen. Professor Martin Wörter von der ETH Zürich, Leiter der Division Innovationsökonomik, fasst dies treffend zusammen:
Die KMU sind das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Sie sind sowohl bei den Beschäftigungszahlen als auch für die Gesamtwirtschaft treibend.
– Professor Martin Wörter, ETH Zürich, Leiter Division Innovationsökonomik
Diese treibende Kraft manifestiert sich in der engen Zusammenarbeit mit Fachhochschulen, Universitäten wie der ETH und spezialisierten Instituten. Anstatt alles selbst zu entwickeln, lagern KMU gezielt Forschungsfragen aus oder beteiligen sich an gemeinsamen Projekten. Dieser Ansatz ist nicht nur kosteneffizient, sondern ermöglicht auch den Zugang zu Spitzenforschung und den neuesten Technologien, ohne die Fixkosten einer eigenen F&E-Abteilung tragen zu müssen.
Dieses Modell der „Open Innovation“ wird durch die Nähe zum Kunden weiter verstärkt. Viele Produktverbesserungen und Neuentwicklungen entstehen direkt aus dem Feedback und den spezifischen Anforderungen der Kunden. Ein Maschinenbauer entwickelt eine massgeschneiderte Lösung für einen einzigen Kunden, die sich später als Standardprodukt etablieren lässt. Ein Softwareentwickler integriert eine Funktion, die von einem Anwender vorgeschlagen wurde. Diese marktgetriebene Innovation ist oft schneller und relevanter als die von Konzernen gesteuerte, strategische Produktentwicklung.

Die Abbildung illustriert diesen Prozess perfekt: Der Austausch zwischen praktischem Handwerk und akademischer Forschung schafft eine Symbiose, die einzigartige Lösungen hervorbringt. Es ist diese Kombination aus externer Kollaboration und interner Agilität, die das Innovationsgeheimnis der Schweizer KMU ausmacht.
Tradition oder Disruption: Welches KMU-Modell überlebt die nächsten 20 Jahre?
Die Schweizer KMU-Landschaft ist geprägt von einem faszinierenden Spannungsfeld: Auf der einen Seite stehen traditionsreiche Familienunternehmen, die seit Generationen für Qualität und Stabilität bürgen. Auf der anderen Seite drängen agile Start-ups mit disruptiven Geschäftsmodellen auf den Markt. Die Frage, welches Modell zukunftsfähiger ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Der Erfolg der nächsten 20 Jahre wird wahrscheinlich in der intelligenten Verknüpfung beider Welten liegen.
Traditionelle Unternehmen punkten mit einem unschätzbaren Wert: Vertrauen. Ihr guter Ruf, ihre langjährigen Kundenbeziehungen und ihr tiefes Branchen-Know-how sind ein stabiles Fundament. Doch in einer sich rasant wandelnden Welt kann diese Stabilität zur Falle werden, wenn sie mit Trägheit einhergeht. Die grösste Herausforderung für Traditionsbetriebe ist die rechtzeitige Adaption digitaler Prozesse, die Erschliessung neuer Vertriebskanäle und die Öffnung für moderne Arbeitskulturen, um für junge Talente attraktiv zu bleiben.
Disruptive Start-ups hingegen haben die Agilität auf ihrer Seite, sind aber oft mit mangelnder Markterfahrung und begrenzten Ressourcen konfrontiert. Ihr Überleben hängt davon ab, ob sie es schaffen, ihre innovative Idee schnell in ein tragfähiges und skalierbares Geschäftsmodell zu überführen. Interessanterweise zeigt sich eine bemerkenswerte Zuversicht in der Branche. Das NZZ-KMU-Barometer belegt, dass 59 % der Schweizer KMU für 2024 eine Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit erwarten. Dies deutet darauf hin, dass viele Unternehmen aktiv an ihrer Zukunftsfähigkeit arbeiten.
Das erfolgreiche KMU der Zukunft wird ein Hybrid sein: Es bewahrt die Werte und die Qualität der Tradition, integriert aber gleichzeitig die Geschwindigkeit und die technologische Offenheit der Disruption. Es wird Unternehmen geben, die den Wandel von innen heraus schaffen, und solche, die durch Übernahmen oder strategische Partnerschaften mit Start-ups neue Impulse erhalten. Wer sich ausschliesslich auf seine Vergangenheit verlässt, riskiert, den Anschluss zu verlieren.
Der Nachfolge-Fehler, der 50% der Schweizer Familienunternehmen scheitern lässt
Die Unternehmensnachfolge ist einer der kritischsten und emotionalsten Momente im Lebenszyklus eines Schweizer KMU. Hier entscheidet sich, ob das Lebenswerk des Gründers oder der Gründerin fortbesteht oder zerbricht. Die Zahlen sind alarmierend: Bei der familieninternen Übergabe scheitert rund die Hälfte der Versuche. Der grösste Fehler ist dabei oft nicht betriebswirtschaftlicher, sondern menschlicher und planerischer Natur: die Nachfolge wird zu spät, zu unstrukturiert und ohne klare Kommunikation angegangen.
Oft wird das Thema aus Angst vor Konflikten oder dem Loslassen der Kontrolle verdrängt. Doch eine erfolgreiche Übergabe ist ein mehrjähriger Prozess, kein einmaliger Akt. Es müssen nicht nur rechtliche und finanzielle, sondern auch emotionale Hürden überwunden werden. Wie die Schweizer Nachfolgeberater in einer Analyse betonen, wird die Komplexität zusätzlich durch den Föderalismus verschärft: „Die unterschiedlichen kantonalen Erbschafts- und Schenkungssteuergesetze machen die Unternehmensnachfolge zu einem komplexen juristischen und finanziellen Spiessrutenlauf.“ Dieser „Kantönligeist“ erfordert eine äusserst sorgfältige und frühzeitige Planung.
Es gibt verschiedene Modelle der Nachfolge, die jeweils eigene Vor- und Nachteile mit sich bringen. Die Wahl des richtigen Weges hängt stark von der individuellen Situation des Unternehmens und der Familie ab. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gängigsten Modelle und ihre Erfolgsquoten.
| Nachfolgemodell | Vorteile | Herausforderungen | Erfolgsquote |
|---|---|---|---|
| Familiennachfolge | Werteerhalt, Kontinuität | Emotionale Hürden, Kantönligeist | 50% |
| Management Buy-Out (MBO) | Erfahrene Führung, Kulturerhalt | Finanzierung, Risiko | Steigend |
| Management Buy-In (MBI) | Frische Perspektive | Kulturwandel, Integration | Zunehmend |
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer offenen Kommunikation, der externen Moderation durch neutrale Berater und dem Mut, auch alternative Modelle wie einen Verkauf an das Management (MBO) oder an externe Führungskräfte (MBI) in Betracht zu ziehen. Ein Scheitern der Nachfolge vernichtet nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch wertvolles unternehmerisches Erbe.
Ihr Aktionsplan für die Nachfolgeregelung
- Frühzeitige Planung: Beginnen Sie mindestens 5-10 Jahre vor der geplanten Übergabe mit der strategischen Planung und definieren Sie klare Ziele.
- Potenzialanalyse: Evaluieren Sie potenzielle Nachfolger (intern und extern) objektiv anhand eines klaren Anforderungsprofils, nicht nur nach familiärer Bindung.
- Rechtliche & Steuerliche Prüfung: Ziehen Sie frühzeitig Experten für Gesellschafts-, Ehe-, Erb- und Steuerrecht hinzu, um die kantonalen Gegebenheiten zu klären.
- Unternehmenswert ermitteln: Lassen Sie eine realistische und unabhängige Unternehmensbewertung durchführen, um eine faire Grundlage für Verhandlungen zu schaffen.
- Kommunikationsplan erstellen: Definieren Sie, wann und wie die Nachfolge an Mitarbeitende, Kunden und Partner kommuniziert wird, um Unsicherheit zu vermeiden.
Von 20 auf 50 Mitarbeitende oder Exit: Die kritischen Entscheidungsmomente für KMU
Während die meisten Diskussionen über KMU deren Gesamtheit betrachten, ist die interne Realität von entscheidender Bedeutung. Gemäss Bundesamt für Statistik haben über 90 % der Schweizer Unternehmen weniger als 10 Mitarbeitende. Diese sogenannten Kleinstunternehmen bilden den Löwenanteil. Doch für die wenigen, die wachsen, gibt es kritische Schwellen, die über die Zukunft des gesamten Betriebs entscheiden. Der Sprung von einem kleinen, informell geführten Team zu einer strukturierten Organisation ist eine der grössten Hürden.
Besonders der Übergang von rund 20 auf über 50 Mitarbeitende stellt eine solche Wachstumsschwelle dar. Bis zu einer Grösse von etwa 20 Personen kann ein Inhaber das Unternehmen oft noch direkt und persönlich führen. Die Kommunikation ist informell, die Prozesse sind flexibel, und die Kultur wird direkt vom Gründer geprägt. Wächst das Unternehmen darüber hinaus, bricht dieses Modell zusammen. Es müssen formale Strukturen, Hierarchieebenen (wie Teamleiter), standardisierte Prozesse und ein professionelles Personalmanagement eingeführt werden. Dieser Wandel ist oft schmerzhaft, da er die ursprüngliche „Familienkultur“ aufbricht.
An diesem Punkt stehen viele Unternehmer vor einer strategischen Entscheidung:
- Wachstum investieren: Den Schritt wagen, in Strukturen und neues Führungspersonal investieren und das Unternehmen auf die nächste Stufe heben. Dies erfordert oft externes Kapital und die Bereitschaft, Kontrolle abzugeben.
- Grösse stabilisieren: Bewusst auf weiteres Wachstum verzichten, um die bestehende Kultur und die direkte Führung zu erhalten. Man optimiert die Effizienz innerhalb der bestehenden Grösse.
- Exit anstreben: Das Unternehmen an einen grösseren Wettbewerber oder einen Investor verkaufen, da man den nächsten Wachstumsschritt nicht selbst gehen will oder kann.
Diese Entscheidung ist weniger eine betriebswirtschaftliche als eine zutiefst persönliche. Sie hängt von der Risikobereitschaft, den Lebenszielen und der Vision des Inhabers ab. Das Ignorieren dieser Wachstumsschwellen führt oft zu Chaos, Überlastung und letztlich zum Scheitern des einst erfolgreichen Betriebs.
Von der ETH in die Fabrik: Wie entsteht Innovation im Schweizer Industrieökosystem?
Das Bild einer Erfindung, die in einem stillen Kämmerlein entsteht, ist längst überholt. In der modernen Schweizer Industrielandschaft ist Innovation ein Mannschaftssport. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist der organisierte und geförderte Wissenstransfer zwischen akademischer Forschung und wirtschaftlicher Anwendung. Institutionen wie die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH) in Zürich und Lausanne sind nicht nur Ausbildungsstätten, sondern auch die Motoren eines pulsierenden Innovationsökosystems, von dem insbesondere KMU profitieren.
Programme wie die von Innosuisse, der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung, spielen hier eine zentrale Rolle. Sie schaffen gezielt Anreize für Kooperationsprojekte. Ein KMU mit einem spezifischen technischen Problem kann sich mit einem Forschungsinstitut zusammentun, das über das nötige Spezialwissen und die Laborinfrastruktur verfügt. Innosuisse unterstützt solche Projekte finanziell und administrativ, wodurch das Risiko für das KMU minimiert wird. So gelangt Spitzenforschung direkt in die Werkshallen und Fabriken und wird in konkrete Produkte und Dienstleistungen umgesetzt.
Fallbeispiel: Der Innosuisse-Effekt
Ein traditioneller Schweizer Maschinenbauer steht vor der Herausforderung, seine Maschinen intelligenter zu machen (Industrie 4.0). Ihm fehlt jedoch das Know-how in den Bereichen Sensorik und Datenanalyse. Durch ein von Innosuisse gefördertes Projekt kooperiert das Unternehmen mit einem Institut der ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften). Die Forschenden entwickeln eine Sensorplattform, während die Ingenieure des KMU ihre Praxiserfahrung einbringen, um die Lösung robust und anwendbar zu machen. Das Ergebnis ist eine neue, „smarte“ Maschinengeneration, die dem KMU einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft.
Dieses Modell des Wissenstransfers ist ein Eckpfeiler der Schweizer Wettbewerbsfähigkeit. Es ermöglicht selbst traditionellen KMU den Zugang zu disruptiven Technologien wie künstlicher Intelligenz, Robotik oder neuen Materialien. Die geografische Nähe und die unbürokratische Kultur der Zusammenarbeit in der Schweiz fördern diesen Austausch zusätzlich. So wird der Weg von der theoretischen Entdeckung an der ETH bis zum marktreifen Produkt in der Fabrik verkürzt und beschleunigt.
Warum zogen 1.000 Fintech-Startups nach Zug statt nach Frankfurt oder London?
Auf den ersten Blick erscheint es wie ein Paradox: Warum sollte ausgerechnet der kleine Kanton Zug zu einem der weltweit führenden Zentren für Blockchain- und Fintech-Innovationen werden und Metropolen wie Frankfurt oder London Konkurrenz machen? Die Antwort liegt in einem perfekten Sturm aus regulatorischer Weitsicht, politischer Stabilität und einem bereits vorhandenen Ökosystem. Zug hat das geschafft, was viele grosse Standorte versäumt haben: Es hat frühzeitig eine klare und verlässliche rechtliche Grundlage für neue Technologien wie die Blockchain geschaffen.
Während Regulierungsbehörden in anderen Ländern zögerten oder mit Verboten reagierten, signalisierte die Schweiz und insbesondere Zug Offenheit. Die FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) veröffentlichte frühzeitig klare Richtlinien für Initial Coin Offerings (ICOs), was den Unternehmen Rechtssicherheit gab. Dieses proaktive Vorgehen, kombiniert mit der traditionellen politischen Stabilität und den attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen der Schweiz, schuf ein unwiderstehliches Umfeld. Die Wirtschaftsförderung des Kantons Zug unterstreicht diesen Punkt: „Zug hat sich zu einem führenden Ziel für Blockchain, Fintech und IT entwickelt. Hier gedeiht Innovation, wo wegweisende Technologien aufeinandertreffen.“
Dieser „First-Mover“-Vorteil löste einen Netzwerkeffekt aus. Pioniere wie die Gründer von Ethereum liessen sich in Zug nieder, was wiederum weitere Talente, Investoren und Dienstleister (Anwälte, Berater) anzog. Es entstand ein sich selbst verstärkendes Ökosystem, das heute als „Crypto Valley“ bekannt ist. Laut dem CV VC Crypto Valley Report gibt es mittlerweile 1.749 aktive Blockchain-Unternehmen in der Schweiz und Liechtenstein, ein Grossteil davon in und um Zug. Diese Konzentration von Fachwissen schafft einen Nährboden für weitere Innovationen, der von grösseren, aber weniger fokussierten Standorten kaum zu replizieren ist.
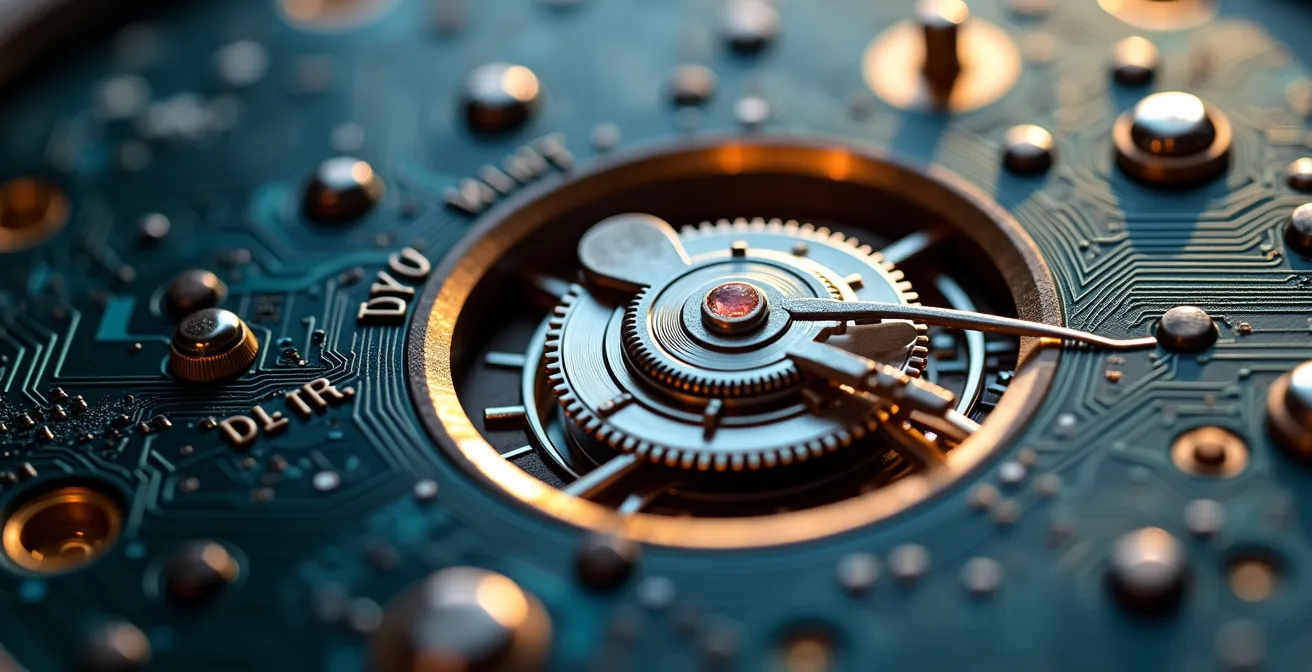
Der Fall Zug ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein kleiner, agiler Standort durch kluge strategische Entscheidungen eine globale Führungsrolle in einer Zukunftsbranche übernehmen kann. Es geht nicht um Grösse, sondern um Geschwindigkeit, Klarheit und den Willen, Neues zu ermöglichen.
Das Wichtigste in Kürze
- Pragmatische Resilienz: Schweizer KMU überleben Krisen nicht durch Grösse, sondern durch schnelle, unbürokratische Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, Geschäftsmodelle agil zu verändern.
- Kollaborative Innovation: Statt auf teure F&E-Abteilungen setzen KMU auf ein vernetztes Ökosystem mit Hochschulen und Partnern, um Zugang zu Spitzenforschung zu erhalten.
- Strategische Nischenbildung: Der Erfolg des Crypto Valley Zug beweist, dass regulatorische Weitsicht und ein fokussiertes Ökosystem es KMU ermöglichen, globale Führungsrollen in Zukunftsbranchen zu übernehmen.
Crypto Valley Zug, digitale Banken: Wie revolutioniert Fintech den Schweizer Finanzplatz?
Die Revolution des Schweizer Finanzplatzes findet nicht nur in den ehrwürdigen Bankpalästen an der Zürcher Bahnhofstrasse statt, sondern massgeblich im Crypto Valley Zug. Dieses Ökosystem ist weit mehr als nur ein Hype um Kryptowährungen. Es ist der Motor für die tiefgreifende technologische Transformation der gesamten Finanzindustrie. Wie ein aktueller Branchenbericht zeigt, sind 41 % aller Schweizer Blockchain-Firmen in Zug ansässig, was die enorme Konzentration von Know-how und Kapital unterstreicht.
Die hier ansässigen Fintech-KMU revolutionieren den Finanzplatz auf mehreren Ebenen. Erstens schaffen sie eine völlig neue Infrastruktur für digitale Vermögenswerte. Unternehmen wie Bitcoin Suisse, ein Gründungsmitglied des Crypto Valley, waren Pioniere bei der Entwicklung von sicheren Speicherlösungen (Custody), Handelsplattformen und Brokerage-Dienstleistungen für Kryptowerte. Sie haben damit die Grundlage dafür geschaffen, dass auch traditionelle Banken und institutionelle Investoren in diese neue Anlageklasse einsteigen können.
Zweitens treiben sie die Innovation bei etablierten Finanzdienstleistungen voran. Von der Tokenisierung von realen Vermögenswerten wie Immobilien oder Kunst bis hin zu neuen, dezentralisierten Finanzprotokollen (DeFi), die das Kredit- und Versicherungswesen verändern könnten – die Impulse aus dem Crypto Valley zwingen die etablierten Player, ihre eigenen Geschäftsmodelle zu überdenken und zu modernisieren. Digitale Banken und Neobanken, die oft eng mit der Fintech-Szene kooperieren, fordern mit schlanken Strukturen und nutzerfreundlichen Apps die Grossbanken heraus.
Diese Entwicklung zeigt eindrücklich, wie ein Cluster von hochspezialisierten KMU eine ganze Branche erneuern kann. Die Kombination aus technologischer Expertise, unternehmerischem Mut und einem unterstützenden regulatorischen Umfeld macht das Crypto Valley zum Labor für die Zukunft des Finanzwesens. Die hier entwickelten Lösungen und Standards werden nicht nur die Schweiz, sondern die globale Finanzwelt nachhaltig prägen.
Die Agilität, die Innovationskraft und die strategische Weitsicht, die im Crypto Valley sichtbar werden, sind symptomatisch für das Potenzial der gesamten Schweizer KMU-Landschaft. Um diese Stärken in Zukunft voll auszuschöpfen, ist es entscheidend, die zugrundeliegenden Mechanismen zu verstehen und die richtigen Rahmenbedingungen für das nächste Kapitel des Erfolgs zu schaffen.