
Der globale Erfolg der Schweizer Biotechnologie beruht nicht nur auf einzelnen Durchbrüchen, sondern auf einem einzigartigen Ökosystem, das Forschung, Industrie und Kapital nahtlos miteinander verbindet.
- Die aussergewöhnliche Innovationsdichte der Schweiz manifestiert sich in einer weltweit führenden Anzahl an Patentanmeldungen pro Kopf.
- Technologien wie die CAR-T-Zelltherapie werden durch die enge Kollaboration zwischen Universitätskliniken (z.B. Inselspital) und der Industrie zur klinischen Realität.
Empfehlung: Um das Potenzial der Branche zu verstehen, muss man über die Technologien hinausschauen und die Mechanismen der translationalen Medizin und des Wissens- und Kapitaltransfers analysieren.
Die moderne Biotechnologie verspricht, einige der grössten Herausforderungen der Menschheit zu lösen – von unheilbaren Krankheiten bis hin zu ökologischen Krisen. Im Zentrum dieser Revolution stehen Begriffe wie CRISPR, CAR-T oder synthetische Biologie. Oft wird dabei die Rolle der Schweiz als globales Kraftzentrum erwähnt, ein kleines Land, das eine erstaunliche Dichte an Innovationen hervorbringt. Viele Analysen beschränken sich darauf, die technologischen Durchbrüche zu beschreiben oder die wirtschaftlichen Erfolge aufzulisten. Sie erklären, *was* passiert, aber selten, *warum* es gerade hier passiert.
Doch was, wenn der wahre Schlüssel zum Verständnis nicht in den einzelnen Molekülen oder Technologien liegt, sondern in der Architektur des gesamten Systems? Dieser Artikel taucht tiefer ein und verfolgt einen zentralen Gedanken: Der Erfolg der Schweizer Biotechnologie ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines fein abgestimmten Biotech-Ökosystems. Es ist ein dynamisches Zusammenspiel von exzellenter Grundlagenforschung an Hochschulen wie der ETH Zürich, der klinischen Anwendung in Spitzen Spitälern, der industriellen Stärke globaler Pharmakonzerne und einer agilen Startup-Szene, die von risikofreudigem Kapital angetrieben wird. Wir werden die Wertschöpfungskette von der ersten Idee im Labor bis zum fertigen Medikament nachzeichnen und dabei die Mechanismen aufdecken, die Entdeckungen in lebensrettende Therapien verwandeln.
Dieser Beitrag beleuchtet die entscheidenden Faktoren, die die Schweiz zu einem weltweiten Hotspot für biotechnologische Innovationen machen. Er analysiert die treibenden Kräfte, die wichtigsten Anwendungsfelder und die ethischen Debatten, die diese zukunftsweisende Branche prägen.
Inhaltsverzeichnis: Die Schweizer Biotech-Revolution entschlüsselt
- Warum kommen 15% aller Biotech-Patente aus einem Land mit 0,1% der Weltbevölkerung?
- Von DNA-Sequenz zur personalisierten Krebstherapie: Die 5 Schritte der Biotech-Entwicklung
- Krebstherapie, resistente Pflanzen oder Bio-Plastik: Welches Biotech-Feld hat Zukunft?
- Wenn Menschen Gene editieren: Wo verlaufen die ethischen Grenzen der Biotechnologie?
- Preclinical, Phase I oder Phase III: In welcher Studienphase Biotech-Aktien kaufen?
- 12 Jahre und 2 Milliarden CHF: Der Weg eines neuen Krebsmedikaments bis zur Apotheke
- Von der Uni ins Spital in die Pharma: Wie entsteht ein neues Krebsmedikament durch Kollaboration?
- Von Herzschrittmachern bis zu KI-Diagnostik: Wie innoviert die Schweizer Medizintechnik?
Warum kommen 15% aller Biotech-Patente aus einem Land mit 0,1% der Weltbevölkerung?
Die schiere Zahl ist verblüffend und unterstreicht die Ausnahmestellung der Schweiz im globalen Innovationswettbewerb. Während das Land nur etwa 0,1 % der Weltbevölkerung ausmacht, stammt ein signifikanter Anteil globaler Biotech-Patente von hier. Dieses Phänomen ist kein Zufall, sondern das Resultat einer beispiellosen Innovationsdichte. Laut dem Patent Index 2024 des Europäischen Patentamts (EPO) erreichte die Schweiz 1140 Patentanmeldungen pro Million Einwohner – mehr als doppelt so viele wie das zweitplatzierte Schweden. Diese Zahlen sind nicht nur Statistik, sie sind der Pulsschlag eines florierenden Ökosystems.
Der Nährboden für diesen Erfolg besteht aus drei zentralen Säulen. Erstens, die akademische Exzellenz: Weltklasse-Institutionen wie die ETH Zürich und die EPFL betreiben Grundlagenforschung auf höchstem Niveau und ziehen Talente aus aller Welt an. Zweitens, die industrielle Stärke: Grosse Pharmaunternehmen wie Roche und Novartis haben ihren Hauptsitz und bedeutende Forschungszentren in der Schweiz. Sie fungieren nicht nur als Innovationsmotoren, sondern auch als Magneten für ein riesiges Netzwerk von Zulieferern und spezialisierten Dienstleistern. Drittens, der Kapitalzugang und die politische Stabilität: Die Biotech-Industrie ist extrem kapitalintensiv. Der Swiss Biotech Report 2025 zeigt, dass die Branche 2024 rekordverdächtige 3,1 Milliarden CHF an Kapital einsammeln konnte. Dieses finanzielle Vertrauen fusst auf einem stabilen rechtlichen und politischen Umfeld, das langfristige Investitionen begünstigt.
Ein entscheidender, oft übersehener Faktor ist die Kultur der Kollaboration. Vier von fünf Biotech-Patenten in der Schweiz entstehen aus internationalen Kooperationen. Dies zeigt, dass der Erfolg nicht isoliert entsteht, sondern durch eine intensive globale Vernetzung, bei der Schweizer Institutionen als zentrale Knotenpunkte agieren. Diese Fähigkeit, Wissen über institutionelle und nationale Grenzen hinweg zu transferieren, ist die wahre Superkraft des Schweizer Biotech-Ökosystems.
Von DNA-Sequenz zur personalisierten Krebstherapie: Die 5 Schritte der Biotech-Entwicklung
Eine der revolutionärsten Entwicklungen der modernen Medizin ist die CAR-T-Zelltherapie, eine Form der Immuntherapie, bei der die eigenen T-Zellen eines Patienten gentechnisch so modifiziert werden, dass sie Krebszellen erkennen und zerstören. Dieser Prozess ist ein perfektes Beispiel für translationale Medizin – die Überführung von Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung in eine konkrete klinische Anwendung. Das Inselspital in Bern hat sich hier als führendes Zentrum etabliert und führt laut eigenen Angaben rund 50% aller CAR-T-Zelltherapien in der Schweiz durch.
Der Entwicklungsprozess von einer wissenschaftlichen Entdeckung bis zu einer personalisierten Therapie wie CAR-T lässt sich in fünf Kernschritte unterteilen:
- Grundlagenforschung & Zielidentifikation: Alles beginnt im Labor. Forscher identifizieren ein spezifisches Molekül (Antigen) auf der Oberfläche von Krebszellen, das als Ziel für die modifizierten T-Zellen dienen kann.
- Präklinische Entwicklung: In Zellkulturen und Tiermodellen wird die Wirksamkeit und Sicherheit des neuen Ansatzes getestet. Hier wird das Design des „Chimeric Antigen Receptor“ (CAR) optimiert, der den T-Zellen ihre neue Fähigkeit verleiht.
- Klinische Studien (Phase I-III): In drei Phasen wird die Therapie am Menschen erprobt. Phase I testet die Sicherheit, Phase II die Wirksamkeit an einer kleinen Patientengruppe und Phase III vergleicht die neue Therapie mit dem bestehenden Behandlungsstandard an einer grossen Patientenzahl.
- Zulassung: Nach erfolgreichen Studien werden die Daten bei Zulassungsbehörden wie Swissmedic eingereicht. Diese prüfen die Ergebnisse eingehend, bevor sie die Therapie für den Markt freigeben.
- Herstellung & Anwendung: Dies ist besonders bei personalisierten Therapien wie CAR-T komplex. Dem Patienten werden T-Zellen entnommen, in einem hochspezialisierten Labor gentechnisch verändert und ihm anschliessend wieder infundiert.
Prof. Dr. med. Christoph Renner, ein Experte auf dem Gebiet, unterstreicht die Bedeutung dieser Technologie:
Die CAR-T-Zelltherapie ist ein Meilenstein in der Krebstherapie, weil sie uns die Möglichkeit gibt, die Krebszellen gezielt zu bekämpfen und die Behandlung für jeden Patienten spezifisch zu gestalten.
– Prof. Dr. med. Christoph Renner, Klinik Hirslanden – Leiter des medizinischen Programms für Zelltherapie
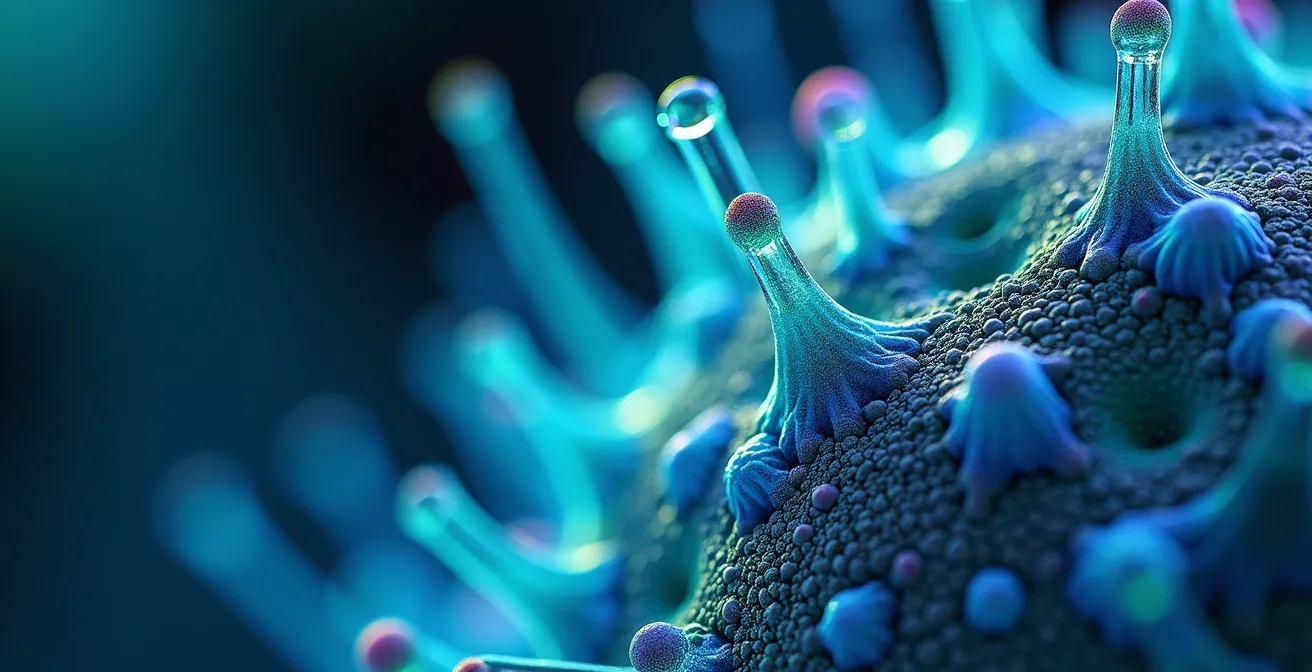
Aktionsplan: Prüfung einer neuen Biotech-Therapie
- Zielmolekül und Mechanismus: Verstehen Sie genau, welches biologische Ziel die Therapie adressiert und wie der Wirkmechanismus funktioniert. Ist er wirklich neuartig?
- Präklinische Daten: Analysieren Sie die Ergebnisse aus Zellkultur- und Tiermodellen. Zeigen sie eine klare Wirksamkeit und ein akzeptables Sicherheitsprofil?
- Design der klinischen Studie: Prüfen Sie die Endpunkte und die Patientenauswahl der klinischen Studien. Sind sie relevant und robust, um einen echten Nutzen nachzuweisen?
- Regulatorischer Pfad: Identifizieren Sie den geplanten Weg zur Zulassung. Gibt es spezielle Programme für seltene Krankheiten oder bahnbrechende Therapien, die den Prozess beschleunigen könnten?
- Herstellung und Skalierbarkeit: Bewerten Sie die Komplexität der Herstellung. Kann die Therapie in grossem Massstab und zu vertretbaren Kosten produziert werden?
Krebstherapie, resistente Pflanzen oder Bio-Plastik: Welches Biotech-Feld hat Zukunft?
Obwohl die medizinischen Anwendungen oft im Rampenlicht stehen, ist die Biotechnologie ein weites Feld mit vielfältigen Anwendungsbereichen, die gemeinhin in Farbkategorien eingeteilt werden. In der Schweiz dominiert eindeutig die rote Biotechnologie (Medizin und Pharma). Laut scienceindustries entfielen auf die Bereiche Pharma, Biotechnologie und Chemie zusammen rund 30% aller Schweizer Patentanmeldungen 2023, was ihre überragende wirtschaftliche und wissenschaftliche Bedeutung unterstreicht.
Doch auch andere Bereiche bergen grosses Potenzial und werden in der Schweiz aktiv beforscht, auch wenn ihre kommerzielle Nutzung teilweise durch regulatorische Rahmenbedingungen beeinflusst wird:
- Grüne Biotechnologie (Landwirtschaft): Hier geht es um die Entwicklung von gentechnisch veränderten Pflanzen, die resistenter gegen Schädlinge sind oder höhere Erträge liefern. Während die Schweiz in der Forschung (z. B. an der Agroscope oder der ETH) stark ist, bremst das GVO-Moratorium die kommerzielle Anwendung im eigenen Land. Der Fokus verschiebt sich daher oft auf alternative Ansätze wie Biopestizide.
- Weisse Biotechnologie (Industrie): Dieser Bereich nutzt Mikroorganismen oder Enzyme, um industrielle Prozesse effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. Anwendungsbeispiele sind die Herstellung von Biokunststoffen, Biokraftstoffen oder die Entwicklung neuer Enzyme für Waschmittel. Schweizer Unternehmen wie Evolva sind hier innovativ, aber das Feld geniesst weniger öffentliche Aufmerksamkeit als die rote Biotechnologie.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Stärken und das Zukunftspotenzial der verschiedenen Biotech-Felder in der Schweiz und zeigt beispielhaft, welche Akteure in diesen Bereichen führend sind.
| Biotech-Feld | Schweizer Stärke | Beispielunternehmen | Zukunftspotential |
|---|---|---|---|
| Rote Biotechnologie (Medizin) | Weltführend | Roche, Novartis, CRISPR Therapeutics | Sehr hoch – CAR-T, Gentherapie |
| Grüne Biotechnologie (Landwirtschaft) | Forschungsstark, aber GVO-Moratorium | Agroscope, ETH-Forschung | Mittel – Fokus auf Biopestizide |
| Weisse Biotechnologie (Industrie) | Innovativ, aber weniger bekannt | Evolva, KIDEMIS | Hoch – Biokunststoffe, Enzyme |
Während die rote Biotechnologie kurz- und mittelfristig der dominierende Wachstumstreiber bleiben wird, birgt insbesondere die weisse Biotechnologie ein enormes, noch nicht voll ausgeschöpftes Potenzial. Die Konvergenz dieser Felder, beispielsweise durch die Nutzung von KI zur Entdeckung neuer Enzyme, könnte in Zukunft zu völlig neuen industriellen Revolutionen führen.
Wenn Menschen Gene editieren: Wo verlaufen die ethischen Grenzen der Biotechnologie?
Die Macht, den Code des Lebens direkt zu verändern, wirft tiefgreifende ethische Fragen auf. Technologien wie CRISPR-Cas9, oft als „Genschere“ bezeichnet, ermöglichen präzise Eingriffe ins Genom. Dies eröffnet fantastische Möglichkeiten zur Heilung von Erbkrankheiten, stellt die Gesellschaft aber auch vor ein Dilemma: Was ist technologisch machbar, was ist ethisch vertretbar und was sollte gesetzlich erlaubt sein? In der Schweiz, einem Land mit einer langen Tradition des gesellschaftlichen Diskurses, wird diese Debatte besonders intensiv geführt.
Die zentralen ethischen Grenzlinien verlaufen zwischen zwei Bereichen: der somatischen Gentherapie und der Keimbahntherapie. Bei der somatischen Therapie werden Körperzellen eines Patienten verändert, um eine Krankheit zu behandeln. Diese Veränderungen sind nicht erblich. Hier besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens, dass dies ein legitimer und wünschenswerter medizinischer Fortschritt ist. Anders sieht es bei Eingriffen in die Keimbahn (Eizellen, Spermien oder Embryonen) aus. Solche Veränderungen würden an zukünftige Generationen weitervererbt und sind in der Schweiz, wie in den meisten Ländern, streng verboten. Die Frage „Ist CRISPR in der Schweiz erlaubt?“ lässt sich also differenziert beantworten: Ja, für die Forschung und für somatische Therapien unter strengen Auflagen; Nein, für vererbbare Eingriffe am Menschen.
Die Forschung steht jedoch nicht still. An der ETH Zürich wird an der nächsten Generation von CRISPR-Werkzeugen geforscht, die noch präziser und sicherer sind. Eric Aird vom Department of Biology beschreibt diesen Fortschritt treffend:
Next generation CRISPR tools can be called molecular taxis. These platforms can shuttle specialized proteins to specific destinations in the genome without the deleterious consequences caused by scissors.
– Eric Aird, ETH Zürich – Department of Biology
Diese „Gen-Taxis“ könnten die Risiken von ungewollten Schnitten im Genom („off-target effects“) minimieren und so die Sicherheit von Gentherapien entscheidend verbessern. Die ethische Debatte verschiebt sich somit kontinuierlich mit dem technologischen Fortschritt. Es geht nicht mehr nur um die Frage *ob*, sondern immer mehr um die Frage *wie* und unter welchen Bedingungen diese mächtigen Werkzeuge eingesetzt werden sollen.

Preclinical, Phase I oder Phase III: In welcher Studienphase Biotech-Aktien kaufen?
Investitionen in die Biotechnologie sind verlockend, aber auch hochriskant. Der Lebenszyklus eines Biotech-Unternehmens ist eng mit den Phasen der Medikamentenentwicklung verknüpft, und jede Phase hat ein eigenes Risiko-Rendite-Profil. Die Frage, wann der „richtige“ Zeitpunkt für einen Einstieg ist, beschäftigt viele Anleger. Eine pauschale Antwort gibt es nicht, aber das Verständnis der Phasen ist entscheidend für eine fundierte Entscheidung.
Generell gilt: Je früher die Phase, desto höher das Risiko und das potenzielle Aufwärtspotenzial. Ein Scheitern in einer späten Phase kann den Aktienkurs ins Bodenlose stürzen lassen.
- Präklinische Phase: Das Unternehmen hat vielversprechende Labor- oder Tierdaten, aber noch keine Ergebnisse am Menschen. Das Risiko eines Totalverlusts ist extrem hoch, da die meisten Wirkstoffe diese Hürde nicht nehmen. Investitionen sind hier reine Spekulation auf einen wissenschaftlichen Durchbruch.
- Phase I (Sicherheit): Die erste Anwendung am Menschen. Positive Sicherheitsdaten können den Kurs bereits beflügeln. Das Risiko ist immer noch sehr hoch, aber der erste grosse Meilenstein ist in Sicht.
- Phase II (Wirksamkeit): Hier zeigt sich, ob das Medikament tatsächlich den gewünschten Effekt hat. Erfolgreiche Phase-II-Daten sind oft der grösste Werttreiber für ein Biotech-Unternehmen und können zu einem massiven Kurssprung führen. Ein Scheitern ist jedoch ebenso wahrscheinlich.
- Phase III (Bestätigung & Zulassung): Die letzte und teuerste Phase vor der Zulassung. Das Risiko ist geringer als in den früheren Phasen, aber ein Scheitern hat verheerende finanzielle Folgen. Ein erfolgreicher Abschluss und die anschliessende Zulassung führen oft zu einer Neubewertung des Unternehmens, da es von einer Forschungs- zu einer kommerziellen Firma wird.
Die Schweizer Erfolgsgeschichte von CRISPR Therapeutics mit Hauptsitz in Zug illustriert diesen Weg. Nach der Gründung auf Basis bahnbrechender Forschung ging das Unternehmen 2016 an die NASDAQ und konnte über die Jahre durch positive Studienergebnisse massiv an Wert gewinnen, bis es schliesslich 2023 mit Exa-cel das erste von der FDA zugelassene CRISPR-Medikament auf den Markt brachte. Grosse Player wie Roche, die laut Europäischem Patentamt mit 754 Anmeldungen 2024 zu den innovationsstärksten Firmen gehörten, verfolgen eine andere Strategie: Sie kaufen oft vielversprechende Unternehmen nach erfolgreichen Phase-II-Studien auf, um ihr eigenes Risiko zu minimieren.
12 Jahre und 2 Milliarden CHF: Der Weg eines neuen Krebsmedikaments bis zur Apotheke
Die schillernden Erfolgsgeschichten und das revolutionäre Potenzial der Biotechnologie verdecken oft eine harte Realität: Die Entwicklung eines neuen Medikaments ist ein extrem langer, teurer und riskanter Prozess. Die im Titel genannten Zahlen – durchschnittlich 12 Jahre Entwicklungszeit und Kosten von bis zu 2 Milliarden Schweizer Franken – sind eine etablierte Grösse in der Pharmaindustrie. Sie erklären, warum die Branche auf enorme Kapitalzuflüsse und robuste Patentlaufzeiten angewiesen ist, um überhaupt innovativ sein zu können.
Woher kommen diese immensen Kosten? Der grösste Teil entfällt nicht auf die Grundlagenforschung, sondern auf die klinischen Studien, insbesondere die grossen, globalen Phase-III-Studien. Diese können Hunderte von Millionen Franken verschlingen, da sie Tausende von Patienten an zahlreichen Standorten weltweit einbeziehen und über mehrere Jahre laufen. Zudem müssen die Kosten für die vielen gescheiterten Projekte – über 90% aller Kandidaten, die in die klinische Entwicklung gehen, erreichen nie den Markt – von den wenigen erfolgreichen Medikamenten mitgetragen werden. Die Schweizer Industrien Chemie, Pharma und Life Sciences investierten allein 2021 rund 6,7 Milliarden CHF in private Forschung und Entwicklung, was die enorme finanzielle Last verdeutlicht.
Eine wichtige Unterscheidung, die die Komplexität weiter beleuchtet, ist jene zwischen Generika und Biosimilars. Während ein Generikum eine exakte chemische Kopie eines kleinen Moleküls ist und relativ günstig hergestellt werden kann, ist ein Biosimilar eine „Nachahmung“ eines komplexen biologischen Medikaments (wie eines Antikörpers). Die Herstellung ist ungleich komplizierter und erfordert ebenfalls aufwendige klinische Studien. Interpharma hebt diese Tatsache hervor und stellt fest, dass allein die Entwicklungskosten für ein Biosimilar das 100-Fache eines Generikums betragen können. Dies zeigt, dass selbst die „Nachahmung“ in der Biopharmazie eine gewaltige wissenschaftliche und finanzielle Herausforderung darstellt.
Von der Uni ins Spital in die Pharma: Wie entsteht ein neues Krebsmedikament durch Kollaboration?
Kein einzelner Akteur kann die komplexe Wertschöpfungskette der Medikamentenentwicklung allein bewältigen. Der wahre Motor des Schweizer Biotech-Wunders ist das, was man als Kollaborations-Dreieck bezeichnen könnte: die nahtlose Zusammenarbeit zwischen akademischer Forschung, klinischer Anwendung und industrieller Kommerzialisierung. Dieses Modell sorgt dafür, dass bahnbrechende Ideen aus dem Labor nicht in der Schublade verschwinden, sondern den Weg zum Patienten finden.
Der Prozess beginnt oft an den Universitäten und Forschungsinstituten. Hier wird die Grundlagenforschung betrieben, die zu neuen Erkenntnissen über Krankheitsmechanismen führt. Diese Entdeckungen werden dann oft in Spin-offs ausgegründet – kleine, agile Unternehmen, die sich auf die Weiterentwicklung einer spezifischen Technologie konzentrieren. Im Jahr 2023 gab es in der Schweiz 308 Biotech-Unternehmen im Entwicklungsbereich, ein Beweis für die Lebendigkeit dieser Startup-Kultur.
Im nächsten Schritt ist die Zusammenarbeit mit den Universitätskliniken (Spitälern) unerlässlich. Hier werden die neuen Therapieansätze im Rahmen von klinischen Studien erstmals am Menschen getestet. Die Mediziner bringen ihre klinische Expertise ein, während die Forscher die wissenschaftlichen Daten analysieren. Physische Orte, die diese Zusammenarbeit fördern, sind von unschätzbarem Wert. Ein Paradebeispiel ist der Campus Biotech in Genf. Er beherbergt akademische Forschungsgruppen der EPFL und der Universität Genf, das Wyss Center for Bio- and Neuroengineering sowie Biotech-Startups unter einem Dach. Diese räumliche Nähe schafft eine dynamische Umgebung, in der Experten ihre Entdeckungen schnell in reale Lösungen umsetzen können.
Schliesslich kommen die grossen Pharmaunternehmen ins Spiel. Sie verfügen über das Kapital, die Erfahrung und die globale Infrastruktur, um teure Phase-III-Studien durchzuführen, die Zulassung zu erlangen und das Medikament weltweit zu vermarkten. Oft geschieht dies durch Lizenzvereinbarungen oder die Übernahme der kleineren Biotech-Firma, sobald deren Technologie einen gewissen Reifegrad erreicht hat. Dieser Kreislauf aus Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung ist das Herzstück des Erfolgs.
Das Wichtigste in Kürze
- Das Schweizer Erfolgsmodell in der Biotechnologie basiert auf einem engmaschigen Ökosystem aus akademischer Exzellenz, industrieller Stärke und gezielter Kapitalförderung.
- Die Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Spitälern und der pharmazeutischen Industrie (translationale Medizin) ist der entscheidende Motor, um Forschung in Therapien zu überführen.
- Während die rote Biotechnologie (Medizin) dominiert, bergen auch die weisse (Industrie) und grüne (Landwirtschaft) Biotechnologie erhebliches, teils noch ungenutztes Potenzial.
Von Herzschrittmachern bis zu KI-Diagnostik: Wie innoviert die Schweizer Medizintechnik?
Während die Biotechnologie oft mit Molekülen und Zellen assoziiert wird, ist die Schweiz ebenso ein globales Kraftzentrum in einem verwandten, aber eigenständigen Feld: der Medizintechnik (Medtech). Dieses Segment umfasst alles von Implantaten wie Herzschrittmachern und künstlichen Gelenken über chirurgische Instrumente bis hin zu hochentwickelten diagnostischen Geräten wie MRT-Scannern. Die Innovationskraft in diesem Bereich ist enorm: Der Medizintechnik-Sektor machte laut EPO 10,5% aller Schweizer Patentanmeldungen im Jahr 2024 aus und war damit das anmeldestärkste Technologiefeld des Landes.
Die Innovationsdynamik in der Medtech-Branche wird zunehmend von der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz (KI) angetrieben. Anstatt nur physische Geräte zu verbessern, liegt der Fokus immer mehr auf der intelligenten Auswertung der Daten, die diese Geräte generieren. KI-Algorithmen können beispielsweise Radiologen dabei unterstützen, Krebs auf CT-Bildern früher und genauer zu erkennen, oder Chirurgen während einer Operation mit Echtzeit-Informationen versorgen.
Diese Konvergenz von Biotech, Medtech und KI ist eine der spannendsten Entwicklungen der Gegenwart. Sie ermöglicht völlig neue Ansätze in der personalisierten Medizin. Ein herausragendes Schweizer Beispiel ist der „Protocol Copilot“ von Unlock Biology. Dieses KI-Tool kombiniert grosse Sprachmodelle (LLMs) mit Transkriptomik-Daten, um Forscher bei der Gestaltung optimierter Protokolle für komplexe Verfahren wie die CAR-T- oder CRISPR-Forschung zu unterstützen. Schweizer Biotech-Teams nutzen solche Werkzeuge, um ihre Labor-Workflows zu beschleunigen und zu verbessern. Dies zeigt, wie die Grenzen zwischen den Disziplinen verschwimmen: Die Hardware (Medtech) generiert die Daten, die Software (KI) analysiert sie, und die Erkenntnisse fliessen direkt in die Entwicklung neuer biologischer Therapien (Biotech) ein.
Die Biotechnologie ist mehr als nur eine Ansammlung von Technologien; sie ist ein Paradigmenwechsel in unserem Verständnis von Biologie und Medizin. Um die Chancen und Herausforderungen dieses Feldes wirklich zu erfassen, ist es entscheidend, die Mechanismen des Schweizer Erfolgsmodells zu verstehen. Die nächste Phase der Innovation wird von der noch tieferen Integration von KI, Datenwissenschaft und Biologie geprägt sein. Um bei dieser rasanten Entwicklung auf dem Laufenden zu bleiben, ist ein kontinuierliches Beobachten der Schnittstellen zwischen Forschung, Klinik und Industrie unerlässlich.