
Der Erfolg Ihres Förderantrags in der Schweiz hängt nicht von der Perfektion des Formulars ab, sondern vom strategischen Verständnis der jeweiligen Förderlogik.
- Die grössten Fehler sind ein unklarer Neuheitsgrad und ein fehlender Nachweis der Wertschöpfung für die Schweiz.
- Innosuisse priorisiert Marktpotenzial und Kollaboration, während der SNF auf wissenschaftliche Exzellenz fokussiert.
Empfehlung: Konzentrieren Sie Ihre Anstrengungen darauf, die einzigartige Neuheit Ihrer Innovation und ihren quantifizierbaren Nutzen für den Wirtschaftsstandort Schweiz überzeugend darzulegen, bevor Sie den Antragsprozess starten.
In einem der innovativsten Länder der Welt bleiben jedes Jahr Fördermittel in Millionenhöhe ungenutzt. Dieser scheinbare Widerspruch ist für viele Gründer, KMU-Unternehmer und Forschende in der Schweiz eine frustrierende Realität. Die Förderlandschaft mit Akteuren wie Innosuisse, dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und diversen kantonalen sowie europäischen Programmen wirkt oft wie ein undurchdringliches Labyrinth. Man hört von den hohen Anforderungen, der Komplexität der Anträge und den entmutigenden Ablehnungsquoten. Die gängige Reaktion ist, sich entweder in administrative Details zu vergraben oder von vornherein zu kapitulieren.
Doch was, wenn der Schlüssel zum Erfolg nicht darin liegt, noch mehr Zeit in das Ausfüllen von Formularen zu investieren, sondern darin, die strategische Logik hinter den Programmen zu entschlüsseln? Was, wenn die häufigsten Gründe für eine Ablehnung nicht formale Fehler sind, sondern fundamentale Denkfehler, die bereits vor dem ersten geschriebenen Wort eines Antrags passieren? Dieser Artikel agiert als Ihr strategischer Förderberater. Wir beleuchten nicht nur, welche Programme existieren, sondern navigieren Sie durch die Denkweise der Gutachter. Wir decken die unsichtbaren Hürden auf, die Projekte scheitern lassen, und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vorhaben von Anfang an auf Erfolg ausrichten.
Anstatt nur eine Karte der Förderlandschaft zu zeichnen, geben wir Ihnen den Kompass an die Hand, um den direktesten Weg von Ihrer Idee zur Finanzierungszusage zu finden. Wir analysieren die spezifischen Anforderungen für jede Projekt- und Unternehmensphase und zeigen, wie Sie die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Wirtschaft als entscheidenden Vorteil nutzen.
Inhaltsverzeichnis: Ihr Wegweiser durch die Schweizer Förderlandschaft
- Warum bleiben jährlich 200 Millionen CHF Innovationsförderung ungenutzt?
- Von der Idee zur Zusage: Was muss ein Innosuisse-Antrag enthalten, um bewilligt zu werden?
- Grundlagenforschung oder Produktentwicklung: Welches Förderprogramm passt zu meinem Projekt?
- Der Antragsfehler, der 60% der Erstanträge bei Innosuisse scheitern lässt
- Seed-Phase, Wachstum oder Skalierung: Die passende Förderung für jede Startup-Phase
- Vom Labor zum Lizenzvertrag: Welche 7 Schritte zwischen Erfindung und Kommerzialisierung
- Der Subventions-Irrtum, der Kantone 200 Millionen CHF kostet, ohne Jobs zu schaffen
- Von der ETH ins Startup: Wie funktioniert Technologietransfer zwischen Forschung und Wirtschaft?
Warum bleiben jährlich 200 Millionen CHF Innovationsförderung ungenutzt?
Das Paradox der ungenutzten Innovationsgelder in der Schweiz ist weniger ein Zeichen mangelnder Ideen als vielmehr ein Symptom systemischer Hürden. Viele potenzielle Antragsteller, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), fühlen sich von der schieren Vielfalt der Programme überfordert. Die Unterscheidung zwischen nationalen Töpfen wie Innosuisse, dem SNF, kantonalen Angeboten und europäischen Rahmenprogrammen ist oft unklar. Diese Komplexität führt zu einer Lähmung, bevor der Prozess überhaupt beginnt. Gleichzeitig wird der Druck auf die Budgets grösser; so warnen Institutionen wie der Schweizerische Nationalfonds, dass Investitionen im BFI-Bereich gekürzt werden könnten, was die effiziente Nutzung der vorhandenen Mittel umso wichtiger macht.
Ein zweiter entscheidender Faktor ist die Herausforderung, den richtigen Forschungspartner zu finden. Programme wie Innosuisse basieren auf der Kollaboration zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Doch wie findet ein KMU aus dem Mittelland den passenden Experten an der ETH Lausanne oder einer Fachhochschule? Die Switzerland Innovation Parks und die Technology Transfer Offices (TTOs) der Hochschulen sind hierfür die vorgesehenen Anlaufstellen, bleiben aber vielen unbekannt.
Schliesslich ist die administrative Last eine reale Barriere. Die Vorbereitung eines fundierten Antrags kann 90 bis 120 Tage in Anspruch nehmen – eine erhebliche Investition an Zeit und Ressourcen, die viele kleinere Unternehmen scheuen. Ohne frühzeitige Unterstützung durch spezialisierte Coaches oder Förderberater erscheint der Aufwand oft zu gross im Verhältnis zur unsicheren Erfolgsaussicht. Diese drei Faktoren – Komplexität, Partnersuche und administrativer Aufwand – bilden eine unsichtbare Mauer, die verhindert, dass Hunderte von Millionen Franken an wertvoller Förderung dort ankommen, wo sie die grösste Wirkung entfalten könnten.
Von der Idee zur Zusage: Was muss ein Innosuisse-Antrag enthalten, um bewilligt zu werden?
Ein erfolgreicher Innosuisse-Antrag ist weit mehr als eine blosse Formsache; er ist das schriftliche Ergebnis einer strategischen Partnerschaft. Der Kernpunkt, den viele übersehen, ist das gelebte Bottom-up-Prinzip. Die Gutachter wollen keine oberflächliche Kooperation sehen, bei der ein Unternehmen eine Hochschule als reinen „Forschungsdienstleister“ beauftragt. Gefragt ist eine echte, auf Augenhöhe entwickelte Projektidee, die aus der gemeinsamen Diskussion zwischen Wirtschaft und Wissenschaft entsteht. Dieses Prinzip stellt sicher, dass sowohl die wissenschaftliche Neugier als auch ein konkreter Marktbedarf von Anfang an im Projekt verankert sind.
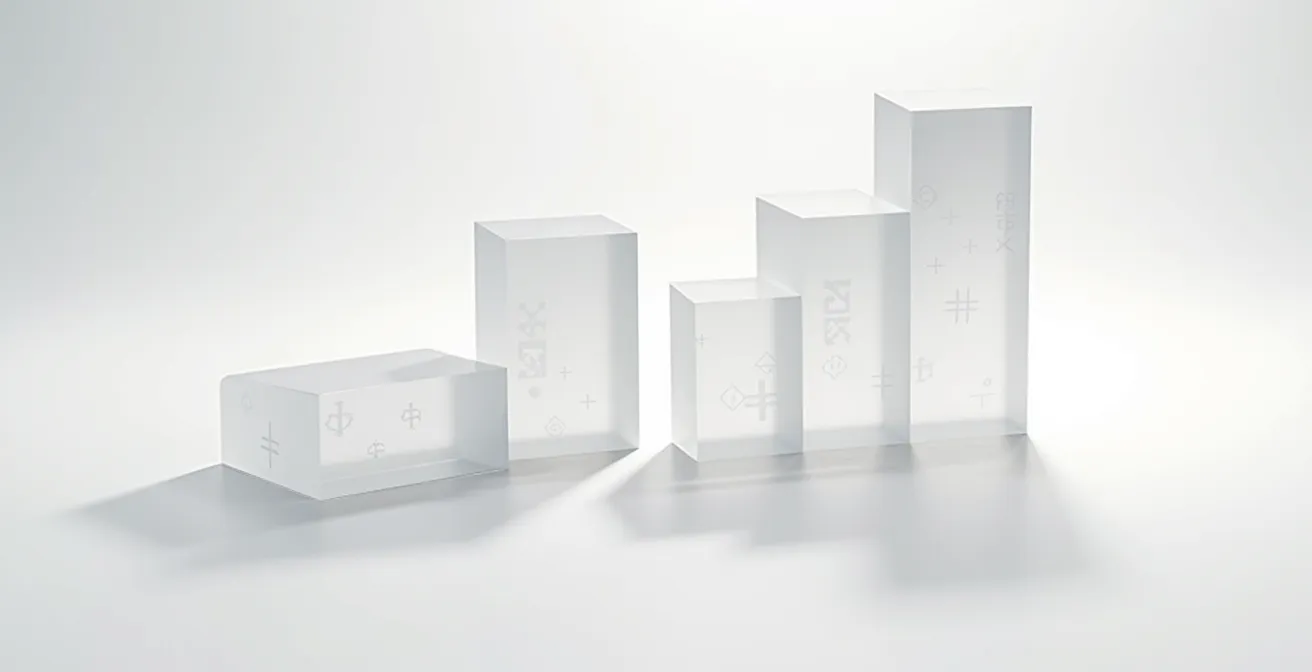
Um diese gemeinsame Entwicklung zu belegen, sind dokumentierte Workshops und Protokolle entscheidend. Der Antrag selbst muss dann drei Kernelemente überzeugend darstellen:
- Der Innovationsgehalt: Hier geht es um die radikale Neuheit. Der Antrag muss klar aufzeigen, was die Lösung von bestehenden Ansätzen weltweit unterscheidet. Eine fundierte Recherche zum Stand der Technik und zu bestehenden Patenten ist unerlässlich.
- Das Wertschöpfungspotenzial: Innosuisse fördert keine Forschung um der Forschung willen. Der Antrag muss quantifizieren, wie das Projekt zur Wertschöpfung in der Schweiz beiträgt. Das bedeutet konkrete Zahlen zu erwarteten Umsätzen, geschaffenen Arbeitsplätzen und dem Potenzial, die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Unternehmenspartners zu stärken.
- Die wissenschaftliche und technische Methodik: Der Arbeitsplan muss realistisch, wissenschaftlich fundiert und klar strukturiert sein. Die jeweiligen Kompetenzen und Beiträge der Forschungsinstitution und des Unternehmenspartners müssen klar ersichtlich und komplementär sein.
Fallbeispiel: Das Bottom-up-Prinzip der Universität Zürich
Die Universität Zürich (UZH) fördert aktiv das von Innosuisse geforderte Bottom-up-Prinzip. Sie ermutigt ihre Forschenden, Projekte direkt mit Unternehmenspartnern zu definieren. Um die Hürden zu senken, stellt die UZH den Forschenden standardisierte, kalkulatorische Stundensätze zur Verfügung, was die Budgetplanung vereinfacht. Für Projekte in einer sehr frühen Phase, in der noch kein Industriepartner an Bord ist, bietet die UZH sogar Unterstützung für Vorprojekte an, um die Idee zur Reife zu bringen. Dieser proaktive Ansatz zeigt, wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit institutionalisiert werden kann, um die Lücke zwischen akademischer Forschung und industrieller Anwendung zu schliessen.
Grundlagenforschung oder Produktentwicklung: Welches Förderprogramm passt zu meinem Projekt?
Die Wahl des falschen Förderinstruments ist einer der häufigsten strategischen Fehler. Jedes Programm hat eine eigene „Förderlogik“, die es zu verstehen gilt. Es ist, als würde man versuchen, mit einem Hammer eine Schraube einzudrehen – das Werkzeug muss zur Aufgabe passen. Die zentrale Weichenstellung in der Schweiz erfolgt zwischen wissenschaftsgetriebener und marktgetriebener Innovation.
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) ist der Hüter der Grundlagenforschung. Sein primäres Bewertungskriterium ist die wissenschaftliche Exzellenz. Ein SNF-Antrag muss eine brillante, originelle Forschungsfrage stellen und eine makellose Methodik zu ihrer Beantwortung vorschlagen. Das Marktpotenzial ist hier sekundär. Ziel ist es, die Grenzen des Wissens zu verschieben. Daher werden Projekte typischerweise zu 100% finanziert, richten sich aber fast ausschliesslich an Forschende an Hochschulen und Non-Profit-Organisationen.
Im Gegensatz dazu steht Innosuisse, die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung. Ihre Mission ist der Wissens- und Technologietransfer. Das entscheidende Kriterium ist hier das Marktpotenzial und die zu erwartende Wertschöpfung für die Schweiz. Ein Innosuisse-Projekt muss eine klare Antwort auf die Frage geben: „Welches Marktproblem lösen wir und wie generieren wir damit Umsatz und Arbeitsplätze in der Schweiz?“ Die Zusammenarbeit zwischen einem KMU und einer Forschungsinstitution ist dabei die Regel. Das KMU trägt stets einen Eigenanteil (typischerweise 50% der Projektkosten), was sein Commitment unterstreicht.
Innosuisse fördert gezielt den Transfer von Wissen und Technologien zwischen den Hochschulen und der Industrie. In der Projektförderung gilt das Bottom-up-Prinzip: Die Projektpartner definieren die Projekte selber.
– Universität Zürich, UZH Forschungsförderung
Zwischen diesen beiden Polen positioniert sich das BRIDGE-Programm, eine gemeinsame Initiative von SNF und Innosuisse. Es schlägt eine Brücke für junge Forschende, die ihre Grundlagenforschung in eine konkrete Anwendung überführen wollen, aber noch am Anfang der kommerziellen Verwertung stehen. Für wissenschaftsbasierte Start-ups, die vor ihrem ersten Markteintritt stehen, gibt es zudem spezielle Innosuisse-Projekte, die bis zu 100% der Kosten decken können.
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede zusammen, um Ihnen bei der strategischen Einordnung Ihres Vorhabens zu helfen.
| Programm | Zielgruppe | Förderart | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| SNF Grundlagenforschung | Forschende an Hochschulen | 100% Forschungsfinanzierung | Wissenschaftliche Exzellenz im Fokus |
| BRIDGE | Junge Forschende | Übergang Forschung zu Anwendung | Gemeinsames Programm SNF/Innosuisse |
| Innosuisse mit Partner | KMU + Forschungsinstitution | Forschungskosten gedeckt, KMU trägt Eigenanteil | Marktpotenzial entscheidend |
| Start-up Innovationsprojekte | Wissenschaftsbasierte Start-ups | Bis 100% Projektkosten | Erstmaliger Markteintritt |
Der Antragsfehler, der 60% der Erstanträge bei Innosuisse scheitern lässt
Während viele Antragsteller sich auf Budgets und Projektpläne konzentrieren, liegt der häufigste und teuerste Fehler in einer viel früheren Phase: dem unzureichenden Nachweis des Innovationsgehalts und der Neuheit. Die Gutachter von Innosuisse sind Experten auf ihrem Gebiet. Eine vage Behauptung wie „unsere Lösung ist besser“ reicht nicht aus. Sie müssen beweisen, dass Ihre Innovation nicht nur eine inkrementelle Verbesserung ist, sondern einen echten, fundamentalen Fortschritt gegenüber dem globalen Stand der Technik darstellt. Viele Anträge scheitern, weil sie diese Hürde nicht überwinden und die Neuheit ihrer Idee nicht überzeugend dokumentieren.
Dieser „Antrags-Denkfehler“ manifestiert sich oft in zwei konkreten Versäumnissen. Erstens wird keine oder nur eine oberflächliche Patentrecherche durchgeführt. Ohne eine systematische Analyse beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) oder in globalen Datenbanken wissen Sie nicht, ob Ihre Idee wirklich neu ist. Zweitens fehlt oft die Abgrenzung zur Konkurrenz. Es genügt nicht zu sagen, dass es in der Schweiz keinen Wettbewerber gibt. Die Perspektive muss global sein. Der Antrag muss klar darlegen, warum bestehende Lösungen das Problem nicht adäquat lösen und worin der einzigartige Vorteil (USP) Ihres Ansatzes liegt.
Dieser Mangel an Differenzierung ist ein kritisches Problem, denn laut Swissmem haben 60% der KMU Schwierigkeiten, ihr Innovationspotenzial voll auszuschöpfen, was sich direkt in der Qualität der Förderanträge widerspiegelt. Die Lösung liegt in einer rigorosen Vorbereitung, die weit über das Schreiben des Antrags hinausgeht. Es geht darum, die Hausaufgaben zu machen und die Einzigartigkeit des Projekts wasserdicht zu belegen.
Checkliste: So vermeiden Sie den häufigsten Antragsfehler
- Umfassende Patentrecherche: Führen Sie eine detaillierte Recherche beim IGE durch und dokumentieren Sie die Ergebnisse, um die Neuheit Ihrer Innovation zweifelsfrei zu belegen.
- Gemeinsame Projektentwicklung protokollieren: Organisieren Sie Workshops mit Ihrem KMU-Partner und erstellen Sie Protokolle. Dies beweist das „Bottom-up-Prinzip“ und die gemeinsame Ideenfindung.
- Wirtschaftlichen Nutzen quantifizieren: Zeigen Sie konkrete Zahlen zur erwarteten Wertschöpfung in der Schweiz auf. Wie viele Arbeitsplätze werden geschaffen? Wie hoch ist das Umsatzpotenzial?
- Strategische Anhänge beifügen: Untermauern Sie Ihren Antrag mit Absichtserklärungen (Letters of Intent) von potenziellen Kunden, einer klaren IP-Strategie und einer Konkurrenzanalyse mit Fokus auf den Schweizer Markt.
- Feedback nutzen: Eine Ablehnung ist kein Ende. Innosuisse gibt oft detailliertes Feedback. Nutzen Sie diese Verbesserungsvorschläge gezielt für eine erfolgreiche Wiedereinreichung.
Seed-Phase, Wachstum oder Skalierung: Die passende Förderung für jede Startup-Phase
Start-ups durchlaufen verschiedene Entwicklungsphasen, und jede Phase hat unterschiedliche Kapitalbedürfnisse. Die Schweizer Förderlandschaft bietet für jede dieser Stufen spezifische Instrumente, doch die richtige Wahl ist entscheidend, um keine wertvolle Zeit oder Anteile (Equity) zu verlieren. Es geht darum, das richtige Kapital zur richtigen Zeit zu sichern.
In der Seed-Phase, wenn die Idee validiert und ein erster Prototyp (MVP) entwickelt wird, ist „Non-dilutive Funding“ – also eine Finanzierung ohne Abgabe von Firmenanteilen – Gold wert. Hier setzen Programme wie das Innosuisse Start-up Training an, das intensive Coaching-Module anbietet. Viele kantonale Förderagenturen und Innovationsparks bieten zudem erste Zuschüsse, um die initialen Kosten zu decken.
Sobald das Start-up in die Wachstumsphase eintritt und erste Markttraktion zeigt, verschiebt sich der Fokus. Hier kommen die Innovationsprojekte für Start-ups von Innosuisse ins Spiel, die helfen, das Produkt zur Marktreife zu bringen. Gleichzeitig wird der Einstieg von ersten Business Angels oder Seed-Fonds relevant. Diese bringen nicht nur Kapital, sondern auch wertvolles Netzwerk und Know-how ein. Finanzierungen erfolgen hier oft über Wandelanleihen (Convertible Loans) oder erste kleine Eigenkapitalrunden.
In der Skalierungsphase, wenn es um die Expansion in neue Märkte und den massiven Ausbau des Geschäfts geht, sind Venture-Capital-Fonds (VCs) die primären Ansprechpartner. Die Förderinstrumente des Bundes treten hier in den Hintergrund, da es nun um signifikante Wachstumsinvestitionen geht, die typischerweise im siebenstelligen Bereich liegen. Die Schweiz hat hier in den letzten Jahren stark aufgeholt, mit einer wachsenden Zahl an professionellen VCs, die auf verschiedene Branchen spezialisiert sind.

Fallbeispiel: Startfeld im Switzerland Innovation Park Ost
Ein exzellentes Beispiel für ein integriertes Förder-Ökosystem ist das Startfeld-Programm im Innovationspark Ost, das 2024 schweizweit zu den Top 3 Startup-Hubs zählte. Es bietet ein umfassendes Paket: In der Seed-Phase erhalten Start-ups ein Förderpaket im Wert von CHF 18’000 als Non-dilutive Funding. Für die nächste Stufe stehen Seed-Finanzierungen bis zu CHF 500’000 über Wandelanleihen oder direkte Beteiligungen (Equity) bereit. Entscheidend ist, dass dieses Kapital mit intensiver Beratung in Strategie, Produkt, Marketing, Finanzen und Recht kombiniert wird, um die Erfolgschancen zu maximieren.
Vom Labor zum Lizenzvertrag: Welche 7 Schritte zwischen Erfindung und Kommerzialisierung
Der Weg von einer brillanten Erfindung im Labor zu einem marktfähigen Produkt ist ein strukturierter Prozess, der als Technologietransfer bekannt ist. An Schweizer Hochschulen wird dieser Prozess professionell von spezialisierten Abteilungen, den sogenannten Technology Transfer Offices (TTOs), begleitet. Bekannte Beispiele sind „ETH transfer“ an der ETH Zürich oder „Unitectra“, das die Universitäten Bern, Zürich und Basel betreut. Diese Organisationen sind die unverzichtbaren Lotsen für Forschende, die ihre Entdeckungen kommerzialisieren wollen.
Der Prozess beginnt lange vor der Kontaktaufnahme mit einem Unternehmen. Der allererste Schritt ist die Erfindungsmeldung beim zuständigen TTO. Dies ist ein entscheidender Moment, denn er initiiert die rechtliche und kommerzielle Prüfung der Erfindung. Das TTO bewertet das Potenzial, klärt die Rechte am geistigen Eigentum (IP) zwischen dem Erfinder und der Hochschule und entscheidet über die Strategie zur Patentanmeldung. Eine verfrühte Veröffentlichung der Forschungsergebnisse kann eine spätere Patentierung unmöglich machen, weshalb dieser Schritt mit höchster Vertraulichkeit behandelt wird.
Sobald die IP-Rechte gesichert sind, entwickelt das TTO gemeinsam mit dem Erfinder eine Verwertungsstrategie. Hier stellen sich grundlegende Fragen: Soll die Technologie an ein bestehendes Unternehmen lizenziert werden? Oder hat sie das Potenzial für die Gründung eines eigenen Spin-offs? Beide Wege haben Vor- und Nachteile. Eine Lizenzierung kann schneller zu Einnahmen führen, während ein Spin-off das Potenzial für eine viel grössere Wertschöpfung birgt, aber auch ein höheres Risiko darstellt. Der folgende Fahrplan zeigt die typischen Meilensteine dieses Prozesses in der Schweiz.
Ihr Fahrplan: Von der Erfindung zur Kommerzialisierung
- Erfindungsmeldung: Reichen Sie Ihre Erfindung frühzeitig und vertraulich beim Technology Transfer Office (TTO) Ihrer Hochschule ein (z.B. ETH transfer, Unitectra).
- IP-Bewertung: Das TTO analysiert die Erfindung und klärt die Rechte am geistigen Eigentum (IP) zwischen Ihnen als Erfinder und der Institution.
- Patentanmeldung: Gemeinsam mit Patentanwälten wird die Patentanmeldung beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) vorbereitet und eingereicht.
- Marktanalyse und Verwertungsstrategie: Das TTO hilft bei der Analyse des Marktpotenzials und der Entwicklung einer passenden Strategie (Lizenzierung oder Spin-off).
- Partnersuche oder Gründung: Identifizieren Sie potenzielle Industriepartner für eine Lizenzierung oder evaluieren Sie die Gründung eines eigenen Spin-offs.
- Lizenzverhandlungen: Führen Sie Verhandlungen über die Konditionen, z.B. exklusive vs. nicht-exklusive Lizenz, Lizenzgebühren (Royalties) vs. Einmalzahlungen (Upfront).
- Vertragsabschluss und Umsetzung: Definieren Sie Meilensteine im Lizenzvertrag und begleiten Sie den Technologietransfer bis zur erfolgreichen Kommerzialisierung.
Der Subventions-Irrtum, der Kantone 200 Millionen CHF kostet, ohne Jobs zu schaffen
Auf kantonaler Ebene existiert eine Vielzahl von Wirtschaftsförderungsprogrammen, die oft mit dem Ziel beworben werden, Arbeitsplätze zu schaffen und die lokale Wirtschaft zu stärken. Doch hier lauert ein verbreiteter Irrtum: die reine Subventionslogik. Werden Gelder nach dem Giesskannenprinzip oder auf Basis politischer Opportunität verteilt, anstatt auf Basis von echtem Innovationspotenzial, verpufft die Wirkung. Eine Förderung, die lediglich bestehende Strukturen erhält oder Unternehmen anlockt, die auch ohne Zuschüsse gekommen wären, kostet Steuergelder, ohne nachhaltige Wertschöpfung zu generieren. Die titulierten 200 Millionen Franken sind hierbei ein symbolischer Wert für die Summe ineffizient eingesetzter Mittel.
Der entscheidende Unterschied liegt zwischen einer passiven Subvention und einer aktiven Innovationsförderung. Eine wirksame kantonale Strategie konzentriert sich nicht darauf, wer das Geld bekommt, sondern darauf, was mit dem Geld passiert. Sie fördert gezielt die Vernetzung von Unternehmen mit lokalen Hochschulen und Forschungsinstituten. Sie investiert in Infrastruktur wie Innovationsparks, die ein kreatives Ökosystem schaffen, in dem neue Ideen und Start-ups gedeihen können. Anstatt nur Schecks auszustellen, agiert eine moderne Wirtschaftsförderung als Moderator, Türöffner und strategischer Partner.
Dieser Paradigmenwechsel ist umso wichtiger in Zeiten knapper werdender öffentlicher Mittel. Wenn der Bund, wie von Experten befürchtet wird, seine Ausgaben für Bildung, Forschung und Innovation (BFI) plafoniert oder gar kürzt, steigt der Druck auf die Kantone, ihre eigenen Mittel so effizient wie möglich einzusetzen. Laut swissuniversities steht der BFI-Bereich vor der Herausforderung, dass mit einem geplanten Plafond von 29.2 Milliarden CHF für 2025-2028 rund 500 Millionen weniger zur Verfügung stehen als ursprünglich von den Institutionen beantragt. Eine strategische, auf echter Innovation basierende kantonale Förderung ist daher kein Luxus, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit.
Das Wichtigste in Kürze
- Verstehen Sie die „Förderlogik“: Der SNF belohnt wissenschaftliche Exzellenz, Innosuisse den erwarteten Markterfolg und die Wertschöpfung für die Schweiz.
- Der häufigste Fehler bei Anträgen ist der unzureichende Nachweis der Neuheit der Innovation und des quantifizierbaren Nutzens für die Schweizer Wirtschaft.
- Echte Zusammenarbeit nach dem „Bottom-up-Prinzip“ zwischen KMU und Hochschulen ist für Innosuisse wichtiger als eine oberflächliche Auftraggeber-Beziehung.
Von der ETH ins Startup: Wie funktioniert Technologietransfer zwischen Forschung und Wirtschaft?
Das Schweizer Innovationsökosystem gilt weltweit als vorbildlich. Ein wesentlicher Grund dafür ist der exzellent organisierte Technologietransfer von den weltberühmten Hochschulen wie der ETH Zürich und der EPF Lausanne in die Privatwirtschaft. Dieser Prozess ist der Motor, der Grundlagenforschung in marktfähige Produkte, neue Unternehmen und hochqualifizierte Arbeitsplätze verwandelt. Es geht darum, das immense Wissen, das in den Laboren generiert wird, nicht in den Schubladen verstauben zu lassen, sondern es für die Gesellschaft nutzbar zu machen.
Das Herzstück dieses Systems sind die bereits erwähnten Technology Transfer Offices (TTOs). Sie agieren als professionelle Schnittstelle und Übersetzer zwischen zwei Welten: der akademischen Welt mit ihrem Fokus auf Publikationen und Erkenntnisgewinn und der industriellen Welt mit ihrem Fokus auf Produkte, Märkte und Profitabilität. Ein Forscher an der ETH, der eine bahnbrechende Entdeckung macht, muss kein Experte für Patentrecht, Businesspläne oder Vertragsverhandlungen sein. Das TTO stellt ihm genau diese Expertise zur Verfügung. Es hilft bei der Bewertung der Erfindung, sichert das geistige Eigentum und entwickelt eine massgeschneiderte Strategie für die Kommerzialisierung.
Dieser strukturierte Prozess hat zur Gründung von Hunderten von erfolgreichen ETH-Spin-offs geführt, die heute in Bereichen wie Robotik, Biotechnologie oder Softwareentwicklung weltweit führend sind. Der Erfolg basiert auf einem klaren Bekenntnis: Forschungsergebnisse sind ein wertvolles Gut, dessen Potenzial systematisch erschlossen werden muss. Diese Philosophie stellt sicher, dass öffentliche Investitionen in die Forschung einen maximalen Ertrag für die gesamte Volkswirtschaft erzielen.
Die führenden Kompetenzen und die angesehene Forschung der Eidgenössischen Technischen Hochschulen, der Universitäten und der Fachhochschulen sollen der Wirtschaft und der Gesellschaft zugutekommen.
– Fostering Innovation Report, Staatliche Innovationsförderung Schweiz
Die Navigation durch die Schweizer Förderlandschaft ist eine strategische Aufgabe. Anstatt sich von der Komplexität abschrecken zu lassen, sollten Sie die unterschiedlichen Logiken der Förderinstrumente als Chance begreifen, Ihr Projekt von allen Seiten zu schärfen. Der nächste logische Schritt für Sie ist nun, eine fundierte Analyse durchzuführen, welches Programm am besten zu Ihrer spezifischen Idee und Ihrer Unternehmensphase passt. Holen Sie sich dafür gezielt Unterstützung.